Ich gestehe, liebe Leserinnen und Leser: Ich habe Sie getäuscht, hinter das Licht und die Fichte geführt, ich habe Ihnen einen Bären aufgebunden. Denn ich habe hier einen Text in der Indiskretion veröffentlicht, der fünf Jahre alt war – und niemand, wirklich niemand hat es gemerkt.
Um das zu erklären, muss ich ein klein wenig ausholen…
Nehmen wir einmal an, ich würde Ihnen vorschlagen, ein neues Tech-Magazin zu starten. Es würde gedruckt werden und als Tablet-App erhältlich sein.
Würde Sie das interessieren?
Sogar schon Themenideen könnte ich Ihnen liefern:
- Drogenkauf im Darknet (und natürlich von allem andere, was da so zu finden ist)
- Ein Portrait der gerade am heißesten angesagten Dating-App
- Neue Mobilitätskonzepte, von Car Sharing bis zu autonomen E-Fahrzeugen, die noch gar nicht auf dem Markt sind
- Eine Bundeswehr-Technik-Story, bei der sich herausstellt, dass der Haken nicht bei maroden Hubschraubern liegt – sondern bei allen Ebenen der IT
- Einsatz von interaktiven Tafeln und Analysetools im Fußball
Wie klingt das?
Dazu noch Gastautoren wie, sagen wir… Gunter Dueck. Richard Gutjahr. Theresa Bücker. Jeff Jarvis.
Interessiert?
Sollte man damit an den Start gehen?
Der Witz ist: Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie exakt dieses Magazin gelesen haben. Allerdings schon 2011.
Denn exakt heute vor fünf Jahren erschien die erste Ausgabe der deutschen „Wired“, deren Chefredakteur ich sein durfte.
Einschub: Das folgende klingt vielleicht nach Eigenlob – doch es ist gemeint als Lob an eine herausragende Mannschaft, die sich leider nur für eine Ausgabe zusammenfinden konnte.
Am 8. September 2011 also erschien das Heft – und schon bevor ich mein Büro erreichte, hatte ich ein Gefühl im Grenzbereich zur Panik – denn ich sah jenes Video von Matthias Richel:
Ein.
Unboxing.
Video.
Und es war nicht das einzige, insgesamt waren es fünf oder sechs, so ich mich recht erinnere, sie würden Abrufzahlen von bis zu 2.500 nach 10 Tagen erreicht haben:
„SEID IHR BESCHEUERT?“, dachte ich, „DAS IST NUR EINE ZEITSCHRIFT!“
Jeder von uns hatte die Erwartungshaltung drastisch unterschätzt. Über 2.000 Tweets beschäftigten sich am Vortag, dem Erscheinungstag und der Woche danach mit dem Heft, 36 Stunden lang war die Wired Trending Topic Nummer 1 in Deutschland. Über 70 Blogartikel entstanden in dieser Zeit.

Denn es passieren ja auch Dinge, die man nicht im Kalkül hatte – zum Beispiel die Sache mit „FAZ“-Mitherausgeber Frank Schirrmacher (die ich nach fünf Jahren verraten darf, glaube ich). Schirrmacher hatte ausrichten lassen, dass er sich auf die deutsche „Wired“ freue. Also fragten wir an, ob er uns die Ehre angedeihen ließe, einen Meinungsbeitrag für die Rubrik „Think“zu verfassen– er sagte sofort zu.
Das war dann das letzte, was wir von ihm hörten. Auch etliche Nachfragen konnten nicht einmal dazu führen, dass er uns ein Thema nannte. Zwei Wochen vor Redaktionsschluss setzten wir eine Deadline, die er mit einer Entschuldigung quittierte: er schaffe es nicht.
Nun gab es ein Problem: Art Director Markus Rindermann hatte für einen substantiellen Geldbetrag bereits eine Grafik zur Illustration der Meinungsautoren angefordert – und in der tauchte Schirrmacher auf. Also brauchten wir als Ersatz einen männlichen Autor, dessen Körperform irgendwie konform war mit der von Schirrmacher. Die Lösung lautete: Gunter Dueck. Er wusste nichts davon, dass Schirrmacher uns abgesprungen war, sagte aber sofort einen Text zu, auch gerne in der Länge von zwei Seiten, die wir Schirrmacher natürlich als einzigem zugesagt hatten.
Welches Thema? Da habe er freie Wahl, sagte ich Dueck. Und bei seiner Antwort musste ich das Prusten am Telefon mühsam zurückhalten: „Also über den Schirrmacher würde ich mich gern mal aufregen…“

Solche Sachen halten auf. Und deshalb musste ich knapp vor Redaktionsschluss selbst ran in Sachen Titelgeschichte – obwohl ich nichts davon halte, wenn Chefredakteure zu viel schreiben, eigentlich sollten sie vor allem führen und managen.
Die Überschrift hatte ich seit der ersten Woche in München im Kopf: „Gebt Deutschland den Geeks (sonst will’s ja keiner)“.
Kommt ihnen bekannt vor?
Stimmt.
Sie haben diese Geschichte, so sie regelmäßig in der Indiskretion vorbeischauen, jüngst hier gelesen. Jener Artikel enthält nur ganz sanfte Korrekturen (wie das Verschweigen des Namens unseres Bundesinnenministers), ansonsten ist er exakt so 2011 erschienen. Aufgefallen ist das niemand unter der mittleren, vierstelligen Zahl von Menschen, die ihn gelesen haben. Selbst eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Digitalszene lobte ihn bei einem privaten Austausch via Twitter.
Bemerkenswert auch: Es war der Artikel in der ersten Ausgabe, der am meisten Kritik auf sich zog. Denn etliche Kommentatoren meinten, es sei doch gar nicht so schlimm bestellt um den Digitalstandort Deutschland. Im Jahr 2016 dagegen kommt mit diesem Argument niemand mehr.
Denn spätestens seit die Politikerkarikatur Günther Oettinger zum Digitalkommissar ernannt wurde, ist klar. Jene Titelgeschichte aus dem Jahr 2011 war noch viel zu sanft.

Ebenso traurig aber ist, dass man die meisten Artikel heute wieder so aufschreiben könnte, so wenig und so wenig kundig wird über Technik in Deutschland berichtet. Diese ganze Latte von Themen oben konnten Sie alle 2011 in der ersten Ausgabe der deutschen „Wired“ finden. Doch über allein das Feld der Mobilität wurde von klassischen Medien beackert, das Darknet fand erst nach dem Anschlag in München breitere Erwähnung, und so wie wir einst Rauschmittel erwarben, versuchte Reinhold Beckmann 2016 eine Schusswaffe zu kaufen.
Das lag natürlich am Team, das auch heute bestens beschäftigt ist:
- Tobias Moorstedt wurde Textchef bei „Neon“ und arbeitet inzwischen für das Journalistenbüro Nansen & Piccard.
- Beatrice Lugger ist heute Geschäftsführerin und Wissenschaftliche Direktorin am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation.
- Christian Jakubetz ist bestens bekannt als Medienkritiker.
- Eva Schulz wirbelt als journalistende Studentin weiter durch die Welt und macht mit ihren tollen Snaps Furore.
- Marcus Rindermann wurde 2014 Art Director des „Focus“.
- Alisa Evdokimov, unsere Bild-Chefin, ist derart umtriebig, dass ich ständig den Überblick verliere

Doch nicht nur thematisch, auch optisch wirkt das Blatt auch 2016 für mich zeitgemäß. Der fantastische Markus Rindermann hatte als Art Director gemeinsam mit David Krebs eine eigenständige Optik geschaffen, die heute vielleicht nur ein wenig schlichter ausfallen würde.
Die Reaktionen auf das Heft waren nicht nur quantitativ überwältigend. Über 53% der Erwähnungen im Social Web waren positiv, nur 18,4% negativ, der Rest neutral (bei dieser von Hand durchgeführten Auswertung wurden Tweets mit dem reinen Hinweis, die „Wired“ gekauft zu haben als neutral gewertet) . Die Hälfte der Kritik bezog sich auf die Bündelung mit der „GQ“: Die ersten Ausgaben der deutschen „Wired“ wurden zwar auch einzeln, vor allem aber in einer Tüte mit dem Herrenmagazin verkauft.
Eine Homepage gab es nicht – aus Kostengründen. Stattdessen hatten wir in einem schlichten Blog Einblicke in die Planung gegeben, um Leser frühzeitig mitzunehmen. Am Erscheinungstag und kurz darauf kommentierten dort 120 Menschen , 90% lobten das Blatt. Hinzu kamen 50 Mails, von denen keine negativ ausfiel. Insgesamt zählte Buzzfeed im Projektzeitraum über 5,3 Millionen Bruttokontakte im Social Web.
Die iPad-App stieg auf Platz zwei der meistverkauften und umsatzstärksten Apps ein, kletterte nach einem Tag auf die Top-Position und hielt sich dort eine Woche. Von den ersten 167 Bewertungen auf iTunes gaben 138 fünf Sterne.

Im Nachhinein waren die Wochen in München eine frustrierende besondere Erfahrung. Mit fünf Jahren Abstand die Dinge, die für mich besonders lehrreich waren:
- Streit ist nötig
Es gab einen Abend, ziemlich gegen Ende der Produktionszeit, da stand das gesamte Team um die ersten Layout-Entwürfe herum – und Markus Rindermann und ich brüllten uns an. Er wollte mehr Platz für die Optik, ich mehr Platz für Texte. „Ich dachte, gleich prügelt ihr euch“, verriet mir später mal ein Teammitglied. Doch genau solche, auch lauten Debatten sind nötig – stille Diplomatie führt meist zu Mittelmaß. - Wenn ein Verlagsmanager sein Produkt mit „brand eins“ vergleicht, sag ihm, er soll die Klappe halten
Jeder Verlagsmanager in Deutschland würden gern die nächste „brand eins“ machen. Die gesamte Berufskaste hält das Magazin für ein ganz tolles, vor allem für ein ganz tolles Erfolgsmodell. Doch keiner will im Gegenzug das tun, was nötig wäre, um eine Zeitschrift vergleichbarer Qualität zu produzieren: Jahre lang durchhalten, zum Beispiel, auch wenn die Zahlen rot sind; oder eine gute Redaktion beschäftigen, die Raum hat, Texte mit freien Mitarbeitern intensiv durchzugehen. Wenn ein Verlagsmanager von „brand eins“ faselt, sollte man ihm dringend raten, still zu sein – mit deutlichen Worten. - Mut zum Aussteigen
Man sollte sich vorbehalten, die Brocken hinzuschmeißen. Nehmen wir nur einmal an, da würde über den Einzelverkaufspreis eines Objektes wie der „Wired“ gesprochen und jemand käme auf die Idee, diesen zwischen 2,50 und 3 Euro zu taxieren – klänge irre, oder? Noch irrer, wenn er als Begründung anführt, dass Magazine, die nur so irgendwie im gleichen Bereich publizieren ja so günstig seien. Also mal bildlich: er schlüge der „brand eins“ vor, sich für 2,75 zu verkaufen, weil es eine „Geld Bild“ für 2,50 gibt. Das ist der Moment, da ein leitender Redakteur mit Abschied drohen, ihn vielleicht gar vollziehen sollte, weil die Marke so wenig verstanden wird, dass sich die Lage nah an der Aussichtslosigkeit bewegt.
Genauso, wenn ein Anzeigenleiter, dessen Team in einem neuen Gebiet von Anzeigenkunden tätig werden soll, auch nach zwei Wochen noch keinen einzigen Anruf getätigt hat, stattdessen aber die Redaktion um Kontakte bittet – und dies vom Geschäftsführer nicht weiter kritisch gewürdigt wird.
Oder aber wenn ein Verlag nicht einmal einen mittleren dreistelligen Betrag monatlich für Social Media-Aktivitäten ausgeben möchte. Vor allem aber: Sobald klar wird, dass ein solches Projekt gleich mit der ersten Ausgabe schwarze Zahlen schreiben soll, verwandele dich in Gandalf, brülle „Flieht, ihr Narren!“ und verlass das Gebäude.
Selbstverständlich würde ich nie behaupten, dass es im Rahmen des „Wired“-Projektes einen dieser Vorfälle gegeben hat. - Neue Medienprojekte brauchen Vorfreude
Was ich nie verstehen werde: Warum kein klassischer Verlag die Idee übernommen hat, Leser für ein neues Projekt digital anzuheizen. Das Redaktionsblog halte ich für einen maßgeblichen Grund, warum eine gehörige Zahl von Menschen solch eine Vorfreude entwickelten. Dabei funktionierte nicht alles, was wir probierten, doch das ist egal. Es geht wie bei Kinotrailern darum, Menschen immer wieder darauf hinzuweisen, dass da etwas kommt, dass es einen gewissen Geist verkörpert und von einem nahbaren und sympathischen Team produziert wird. Diese Leser kann man ja auch mal treffen: Zu einem Redaktions-Meetup im Biergarten kamen zwar nur eine Hand voll Menschen – doch das sind eine Hand voll, die sich intensivst für das Produkt interessieren. - Kritik ist (betteln um) Liebe
Jene oben erwähnte Sentiment-Auswertung mit den weniger als 20% kritischen Stimmen ist noch einmal verzerrt. Denn auf Twitter engagierten sich Kritiker heftiger als Lobende. Wem das Heft gefiel, der tweetete einmal – wem es nicht gefiel, der tat dies über Stunden in bis zu 10 Tweets kund. Diese Kritiker wollten nicht nur gehört, nein, sie wollten verbreitet werden. Genau deshalb sollte man auch jene angeblichen Erregungswellen und Shitstorms im Web genauer betrachten: Kritik ist unterhaltsamer und emotionaler als Lob. Lob ist langweilig, wenn man es breit tritt, man selbst kommt sich komisch vor, wenn man lange Lobes-Elogen verfasst. Kritik dagegen ist witzig und beißend und wild – und fällt deshalb stärker auf. Deshalb auch waren Blogs deutlich kritischer als Twitterer – ein Blog-Artikel braucht mehr Inhalt als „Gutes Heft, hab ich gern gelesen.“
Fünf Jahre später ist die deutsche „Wired“ marginalisiert. Zu lange konnte sich der Verlag nicht durchringen, Vollgas zu geben. Als er es tat, waren die möglichen Leser längst zu verwirrt ob der merkwürdigen Erscheinungszyklen. Nur ein erhebliches Marketing-Investment hätte Aufmerksamkeit schaffen könnten.
Seit diesem Jahr erscheint die deutsche „Wired“ nur noch viermal im Jahr, jeweils monothematisch. Die Facebook-Seite zählt zwar über 35.000 Likes, doch die sichtbare Interaktion mit den Beiträgen bewegt sich nahe der Nulllinie (obwohl die Reichweite natürlich trotzdem sehr gut sein kann) – auch aufgrund der handwerklichen Fehler, die bei vielen Verlagsangeboten zu beobachten sind.
In der digitalen Debatte findet Wired Deutschland (zumindest in meiner Filterblase) kaum statt, „t3n“ taucht deutlich häufiger auf. Wired.de startete mit einem merkwürdigen Layout und ist inzwischen wenigstens lesbar.

Die gesamte Ausrichtung hat sich schon vor Jahren massiv verändert. Wir wollten damals fortschrittsoptimistisch sein. Dass ein anderer Chefredakteur dies anders machen will ist absolut richtig, jeder Chef muss sein Akzente setzen. Allein: Fortschrittspessimistisches gibt es reichlich im deutschen Medienmarkt. Und wer macht, was die Konkurrenz macht, muss es besser oder billiger tun.
Wenn ich heute auf Wired.de blicke, dann lesen sich die Überschriften nicht anders als die von technophoben Nachrichtenanbietern: von einem „Youtube-Drama“ ist die Rede, als ich dies vor ein paar Tagen schrieb, von den „Problemen“ bei Augmented Paper, vom „Rückschlag“ und „Geldverlust“ für SpaceX und Brauereien, denen Bierflaschen ausgehen. Gestern Abend nun die Apple Keynote – von Wired Deutschland dazu kein Wort um 8 Uhr am Morgen.
Noch immer glaube ich, dass eine „Wired“ genau das Magazin ist, das Deutschland brauchen könnte. Allein: Diese „Wired“ unterscheidet sich nicht vom Rest der Medienangebote, weshalb ich nicht glaube, dass sie im Jahr 2018 noch existieren wird. Und deshalb ist dieser fünfte Geburtstag für mich ganz persönlich auch ein sehr trauriger Tag.

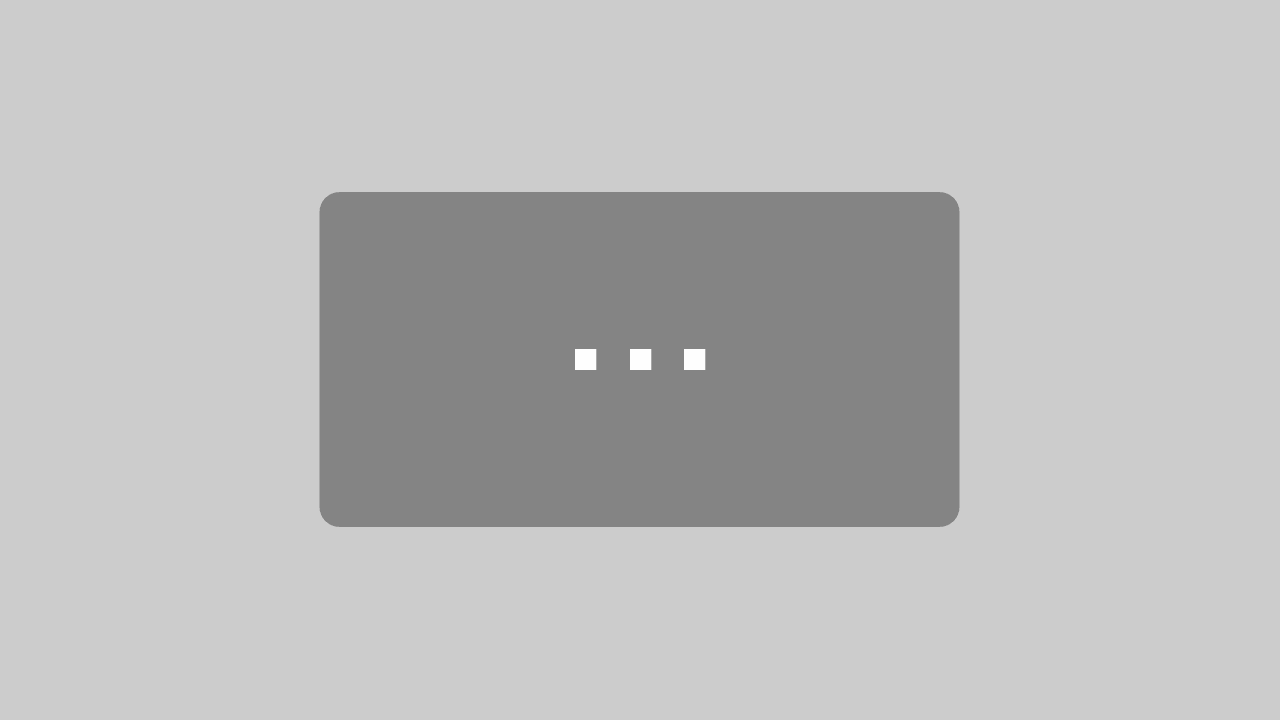




Keine Kommentare vorhanden