Den folgenden Text habe ich für die Preispublikation des Grimme Online Award 2013 verfasst. Der Stand ist deshalb nicht ganz neu, erschienen ist die Publikation am 21. Juni. Die weiteren Texte darauf finden Sie unter diesem Link.
In deutschen Zeitungen und Zeitschriften ist selten die Rede von Alle-Autos-in. Auch die Karrierebibel taucht selten auf, genauso wenig wie Whudat. Exciting Commerce? Fehlanzeige.
Das ist insofern bemerkenswert, als dass die gleichen Publikationen voll sind mit den Klagen der Branchenvertreter aus der Print-Gemeinde. „Nur lausige Pennies“ gebe es im Web zu verdienen, wird zum Beispiel gern Verleger Hubert Burda zitiert. Einhellig scheint klar: Im Internet kann man kein Geld mit Journalismus verdienen.
Komisch. Denn die oben genannten Angebote sorgen für den Lebensunterhalt ihrer Macher. Sie gehören nicht zu Verlagen und refinanzieren sich über Werbeeinnahmen. So beschäftigt die Karrierebibel, ein Blog zu Management- und Karrierethemen, zwei Redakteure. Das E-Commerce-Fachblog Exciting Commerce erzielt Einnahmen im mittleren sechsstelligen Bereich und das Auto-Magazin Alle-Autos-in ist mit seiner Handvoll Mitarbeiter seit drei Jahren in den schwarzen Zahlen.
Glaubt man den wimmernden Medienkonzernen dürften diese Beispiele, es sind nur einige von vielen, nicht existieren. Allein: Selbst Verlagsangeboten geht es nicht so schlecht, wie sie gerne tun. Die Online-Ableger von „Spiegel“, „Focus“ und „Rheinischer Post“ sind, um nur einige zu nennen, profitabel.
Ja wie denn nun? Lässt sich mit journalistischen Inhalten im Web Geld verdienen oder nicht? Die Antwort lautet: Ja – aber.
Natürlich fallen die Renditen nicht mehr so himmlisch hoch aus wie einst im Zeitungsgeschäft. Alles andere wäre auch wider die ökonomische Logik Denn weder der Printbereich noch TV und Radio sind funktionierende Märkte: Der Zugang ist reguliert, der Einstieg mit enormen Kosten verbunden. Im Web fallen diese Schranken, und so wurde innerhalb einer Dekade aus einem starren Oligopol mit hohen Renditen ein Polypol auf Speed. Und wenn Märkte aufbrechen bedeutet das eben für die angestammten Marktteilnehmer eine Flut neuer Konkurrenten.
Dieser Wandel vollzieht sich rasend schnell und disruptiv. Somit wäre ein gewisses Maß an Verständnis und Mitleid für die Betroffenen nicht falsch – wenn sie selbst sich nicht in fast kindischer Weise gegen Veränderungen stemmen? würden. Es fällt einfach schwer nach vorne zu denken, wenn pauschal die Möglichkeit bestritten wird, mit Journalismus im Netz werbefinanziert Geld zu verdienen (und keine Sorge: Über Paid Content reden wir später auch). Angesichts der Zahlen von Spiegel Online & Co. wird behauptet, da subventioniere das Print-Geschäft die Web-Aktivitäten, Artikel würden zu Billigpreisen ins Netz geschoben – und deshalb falle die Bilanz eben positiv aus. Wer so spricht, wirft den zugehörigen Verlagen Bilanzfälschung vor. Denn jene Zahlen sind offiziell im Bundesanzeiger veröffentlicht und müssen deshalb dem Anspruch genügen, den realen wirtschaftlichen Zustand der Unternehmen abzubilden – so ist es Recht und Gesetz. Möglicherweise erklärt das auch, warum die meisten Verlage die Bilanzen ihrer Online-Töchter nicht veröffentlichen: Sie fallen besser aus, als sie zugeben mögen.
Was also muss passieren? Es gibt keine Standardlösungen und keine Allheilmittel mehr für die Frage, wie Journalismus sich refinanzieren soll, aber es gibt Denkansätze.
Als Alan Rusbridger seinen Posten als Chefredakteur des „Guardian” antrat, sagte er sinngemäß: „Wer glaubt, sich nicht um das Thema Internet kümmern zu müssen, kann gehen.” Recht hat er. Ein Journalist, für den Online-Nachrichten und Social-Media-Dienste nicht Alltag sind, kann heute seinen Job nicht mehr ausüben. Etwas verblümter vertritt diese Meinung auch Lionel Barber, Chefredakteur der „Financial Times”. In einer E-Mail anlässlich des Abbaus von 35 Mitarbeitern schrieb er: „Natürlich müssen wir bei den erprobten Praktiken guten Journalismus bleiben… Aber wir müssen anerkennen, dass das Internet neue Straßen öffnet und neue Plattformen für eine bereicherte Lieferung und Verteilung von Informationen.“
Wer in deutschen Verlagen sollte so etwas schreiben? Die meisten Entscheider – egal ob Geschäftsführer oder Chefredakteur – benehmen sich wie Kreuzfahrttouristen: Sie spazieren in großen Gruppen geführt durch Palma de Mallorca, und behaupten hinterher: „Malle, kenn isch!“ Tatsächlich aber müssten sie einen Rucksack packen und ins Hinterland wandern, bei Einheimischen übernachten und an ihrem Tisch speisen. Das ist unbequem und kostet Zeit – aber nur so lernt man ein unbekanntes Terrain kennen.
Quer durch Medienhäuser bräuchten Mitarbeiter Schulungsprogramme, die weit über „Ein Kollege erzählt mal zwei Stunden was über Twitter” hinausgehen. Das Management und die Chefredaktionen müssen sich intensiv – und außerhalb von Print-Branchenbeschmusungen – mit diesen Themen beschäftigen, Besuche bei Fach-Treffs sollten selbstverständlich sein. Und bei der Rückkehr muss dafür gesorgt sein, dass Eindrücke und Einschätzungen nicht im privaten Notizbuch versanden, sondern systematisch im Unternehmen geteilt werden: mit Vorträgen, Newslettern, einer Wissensdatenbank. Auch kann es nicht sein, dass neue Web-Dienste von Journalisten oder Medienmanagern zuletzt verwendet werden – sie müssen bei den ersten sein, die das tun.
Immerhin geht ein Medienkonzern einen spannenden Schritt nach vorn: Axel Springer. Er schickte Marketing-Chef Peter Würtenberger, „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann und Startup-Gründer Martin Sinner für rund ein Jahr ins Silicon Valley, um Kontakte zu knüpfen und ein Gefühl für Innovationen zu bekommen. Wer Diekmann seitdem erlebt, trifft einen Journalisten mit brennender Begeisterung für alles Neue. Wir dürfen ahnen: Er wird im Umgang seiner Redaktion mit digitalen Innovationen einen maßgeblichen Wandel einleiten.
Die Lebenslüge der Medienkonzerne formulierte Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo vergangenes Jahr so: „Hierzulande gibt es die wohl besten Zeitungen der Welt.“ Sie sollten nur aufhören, sich selbst so schlecht zu finden, so der Tenor des Leitartikels. Die Leser spielten in der länglichen Jubelstrecke über klassische Medien keine große Rolle.
Anscheinend konsumiert di Lorenzo selten Angebote wie das Bildblog. In dessen Texten offenbart sich der brutale Qualitätsverlust quer durch den Mediengarten – es ist ein Trauerspiel. Die Leser haben das längst erkannt, die Auflagen der Zeitungen fallen seit 20 Jahren. Im Netz sinkt das Niveau noch weiter: Egal ob Welt.de oder das Netz-Angebot der „Deister- und Weser Zeitung“ – der Leser findet die immer gleiche Melange aus Agenturmeldungen, im Internet zusammengeklaubten und auf Boulevard geschriebenen Geschichtchen und Klickstrecken in einem Design, das zwei Drittel des Bildschirms mit Werbung flutet. Multimediale Experimente, gekonntes Spiel mit Social-Media-Plattformen oder interaktive Grafiken sind so selten, dass fast jedes auftauchende Beispiel gleich für Begeisterungsstürme sorgt. Selbst größere Redaktionen schaffen keinen intelligenten Datenjournalismus, wie ihn bei der „New York Times“ die Ein-Mann-Show Nate Silver mit seinem Blog FiveThirtyEight vorexerziert. Das Schlimmste aber ist: In old Germany versucht es auch niemand.
Einen Klick weiter erwartet die Leser eine andere Welt. „Journalismus ist keine exklusive Profession mehr. Journalismus ist zu einer Aktivität geworden, die nur noch von einer Minderheit professionell ausgeübt wird. Ob ein Journalist professionell ist, bemisst sich nicht mehr daran, ob er mit seiner Arbeit Geld verdient, sondern allein daran, ob er professionelle Standards einhält, etwa in der Sorgfalt und Fairness seiner Recherche und der Qualität seiner Sprache.“ Das schrieb Wolfgang Blau, der Digital-Stratege des „Guardian“, noch in seiner Zeit als Online-Chef der „Zeit“ in einem Beitrag für die „Süddeutsche Zeitung“.
Längst sind hierzulande ökonomische Analysen im Blog Die wunderbare Welt der Wirtschaft tiefer und ausgewogener als bei Handelsblatt.com, die taktischen Analysen von Bundesligaspielen bei Spielverlagerung ausführlicher und kompetenter als beim „Kicker“ und Der Postillon ist lustiger als Titanic.de. Das gilt nicht für jedes Interessensgebiet – aber für immer mehr. Selbst im Lokaljournalismus tut sich etwas: Der freie Journalist Hardy Prothmann schreibt in seinem Heddesheim-Blog kritischer als der örtliche „Mannheimer Morgen“ – und macht damit 1.500 Euro im Monat. Doch ob die Autoren Geld verdienen ist zunächst unerheblich: Sie liefern hochqualitative Artikel einfach aus Leidenschaft ab und sind so neue Konkurrenz für alte Medien.
Wer Konkurrenz bekommt, muss besser werden. Doch wie sollen Redaktionen besser werden, die bis auf die Knochen heruntergespart wurden? Wie sollen freie Journalisten besser werden, die zu erschreckenden Hunger-Honoraren zu überleben versuchen? Unausweichlich ist eine Ressourcenumverteilung, die zum Ende eines alten Redaktionsspruchs führen wird: „Wir müssen die Nachrichtenlage abdecken.“
Traditionell versuchen Zeitungen genau das: Allen alles bieten, die Welt zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses abbilden, von Lokal- bis Weltpolitik, von Kreisliga B bis Bundesliga. Das war logisch, solange sie das einzige Informationsmedium und somit die zentrale Anlaufstelle für die Leser waren. Doch deckte sich dies nie mit den persönlichen Wünschen der einzelnen Leser. Beispiel: Der Anhänger des SC Preußen Münster wird bei seinem Umzug nach Düsseldorf nicht von der „Rheinischen Post“ mit Informationen über seinen Lieblingsclub bedient. Zeitungen orientieren sich an einem imaginären Durchschnittsleser – und treffen so bei keinem Leser die exakten Interessen. Das war hinnehmbar, so lange keine Alternative vorhanden war.
Social Media hat die Nachrichtenfilterung drastisch verändert. Zu jedem Zeitpunkt erfahren Menschen heute via E-Mail, Facebook oder Twitter von den Nachrichten, die sie tatsächlich interessieren. Hinzu kommen innovative Filter wie Flipboard, Zite oder Rivva. So landet heute weniger als die Hälfte aller Leser auf der Startseite eines Nachrichtenangebots. Die Tipps ihrer Kontakte auf Facebook oder Twitter sowie die Sucherergebnisse von Google oder Bing lotsen sie direkt auf die Artikel, die am besten recherchiert und am schönsten geschrieben sind, und auf die Videos, die besonders hinguckenswert sind. Somit ist der Leser 2013 besser informiert als je zuvor.
Diese Leserflüsse stehen kaum im Fokus von Nachrichtenredaktionen. Viel Aufwand wird betrieben, die Startseite ständig aktuell zu halten. Doch was Quereinsteiger vorfinden, scheint egal. Erfolgreiche Online-Unternehmen machen es vor: Händler und Gaming-Unternehmen schrauben ständig an ihrem Design, achten sehr genau darauf, was das Design von Schaltflächen oder die Bildgröße am Nutzerverhalten ändert. In Verlagen ist das kaum ein Thema. Sie müssten viel stärker darauf achten, wann Artikel aktualisiert, korrigiert, vielleicht auch einmal gelöscht werden müssen. Und ebenso wenig starten sie selbst einen neuen Nachrichtenfilter wie eben Flipboard. Auch hier ist das eigentlich Entsetzliche: Sie versuchen es nicht einmal.
In ihrer Gemeinsamkeit haben Deutschlands Verlage eine ominöse Gratiskultur im Internet ausgemacht, der es an den Kragen gehen soll. Ihr Auftragskiller: „Paid Content“. Nur: Er wird ins Leere schießen – denn diese Gratiskultur existiert nicht. Die Nutzer zahlen im Web für immer mehr Inhalte und Dienste, egal ob es Musik und Filme bei iTunes sind, E-Books, Präsentationshilfen oder virtuelle Notizbücher.
Doch glauben die Medienmacher tatsächlich, dass ihre Leser für jene oben beschriebene Qualität zahlen? Sie werden es absehbar nicht in einem ausreichenden Maß tun, egal ob die Bezahlschranke beim ersten Artikel oder beim zehnten fällt. Denn bei Nachrichteninhalten ist klar: Ihre Qualität kann erst nach dem Konsum beurteilt werden, doch mehr als einmal wird der Leser sie nicht nutzen.
Wer mit Paid Content erfolgreich sein will, braucht neue Inhalte. Da müssen Tablet-Magazine den Leser mit multimedialen Inhalten bannen und Wirtschaftsanalysen so fachspezifisch sein, dass sie im Rahmen einer Nachrichtenseite nicht mehr interessant sind – weil nur ein geringer Teil der Leser sich so tief in das Thema einarbeiten möchte. Sprich: Diese Inhalte fallen nicht nebenher ab, sondern sind ein eigenes Geschäftsfeld, in das investiert werden müsste. Auch hier gilt: An Versuchen mangelt es.
Für die allermeisten Nachrichtensites wird deshalb die Refinanzierung über Online-Werbung das wichtigste Standbein bleiben. Auch hier begingen die Medienhäuser in der Vergangenheit kapitale Fehler. So überließen sie die Entwicklung von Innovationen, zum Beispiel das gezielte Anzeigen von Bannerwerbung, externen Unternehmen – die selbstverständlich einen Anteil vom Werbekuchen abhaben möchten. Versäumt haben sie die Chance, sich selbst als Vermarkter der Vielzahl neuer, kleiner Seiten zu etablieren. All diese? Blogs, Communities oder Online-Magazine sind auf Plattformen mit niedrigpreisiger Werbung angewiesen wie zum Beispiel Google Adsense oder Criteo. Für sie wäre ein Vermarkter mit Ansehen und etablierten Vertriebsstrukturen eine Wohltat.
Versehen mit solch breiter Marktmacht hätten die Verlage daran gehen können, ihren Kardinalfehler auszubügeln: Das Hinnehmen von Page Impressions und Visits als wichtigster Werbewährung. Diese Kriterien sind für vieles verantwortlich, was von Nutzern an Online-Nachrichten kritisiert wird: Klickstrecken, auf mehrere Seiten verteilte Texte, die Flut beliebiger Artikel.
Sinnvoller wäre eine Etablierung der Verweildauer als Maßstab. Sie würde Reportagen fördern, die den Leser fesseln, ebenso das Spiel mit Multimedia-Grafiken und Videos oder Audioelemente. Es gehört zu den großen Rätseln der Medienindustrie, warum sich ihre Mitglieder in diesem Punkt nicht solidarisiert haben – gleichzeitig aber in so vielen anderen Punkten Lobbyismus für sich selbst betreiben.
Und wo bleiben die Journalisten? Theoretisch eröffnen sich ihnen die wundervollsten Chancen. Zum ersten Mal in der Geschichte ihres Berufsstandes können sie ihre Arbeit von Zwängen befreit ausüben, können ihre Geschichten mit freier Wahl des Mediums erzählen, in beliebiger Länge und zu jeder Zeit. Umso erstaunlicher ist die Abneigung vieler Journalisten gegen die digitale Welt. Mit Entsetzen verfolgten Freunde digitaler Kommunikation zum Beispiel die Bundespressekonferenz im März 2011. Regierungssprecher Steffen Seibert sah seine Nutzung von Twitter als ganz normal an – im Gegensatz zu Hauptstadtjournalisten. Die ergingen sich vor laufenden Kameras in Äußerungen wie „Der Nachrichtendienst Twitter ist nicht sicher. Ich habe vorhin im Internet nachgeschaut.“ Oder dem Hinweis, ältere Mensch seien mit „diesen neumodischen Kommunikationsformen nicht so vertraut“.
Dabei könnten sie sich unabhängiger machen von ihren Arbeitgebern. Das bedeutet nicht, dass sie zwingend Freiberufler werden müssen. Nur wird der angestellte Redakteur von seinem Arbeitgeber – oder von potenziellen Abwerbern – mehr Achtung erfahren, wenn er selbst aktiv Leser um sich schart.
Verlage könnten sich dies zum Vorbild nehmen und Modelle aus der Startup-Szene adaptieren. Mitarbeiter, die für eine Idee brennen, dürften sich auf dieses Feld konzentrieren und erhielten eine Finanzierung mit klar definierten Erfolgskriterien. Werden diese Kriterien verfehlt, muss abgewogen werden: Wird das Projekt eingestellt oder erhält es eine neue Finanzierungsrunde? Ist es ein Volltreffer, werden seine Macher am Erfolg beteiligt. Ergebnis: hohe Identifikation der Mitarbeiter und ein Klima des Aufbruchs.
Sowohl freie Journalisten als auch Medienhäuser müssen sich allerdings auf eine Fraktalisierung der Einnahmeströme einrichten, wie sie in vielen Branchen Alltag geworden ist. Aus dem Hersteller eines Produktes wird eine Marke und somit aus der simplen Hersteller-Kunde-Beziehung ein Geflecht aus verschiedenen Leistungen. So werden unabhängige Autoren ihren Lebensunterhalt künftig vielleicht mit dem Verkauf von Artikeln, dem Betrieb eigener Seiten, E-Books, Schulungen und Vorträgen finanzieren. Bei Medienhäusern liegen Veranstaltungen oder Weiterbildungsmaßnahmen nahe. Eventuell werden Zeitungsausträger künftig auch andere Waren liefern. Das „Handelsblatt“ setzt dagegen auf ein Recherche-Institut für den Mittelstand.
Beliebig dürfen diese Aktivitäten nicht werden – Marken-Konsistenz wird entscheidend für ihren Erfolg sein. Der wichtigste Gradmesser ist dabei die Homepage, denn sie ist der häufigste und wichtigste Kontaktpunkt mit dem Leser. Wer zum Beispiel nach Düsseldorf zieht, für den wird RP Online der erste Kontakt mit der „Rheinischen Post” sein. Wird er angesichts der Billig-Positionierung, dem mit Werbung zugepflasterten Angebot, Monate alter Meldungen auf Rubriken-Startseiten oder billigsten Klickstrecken weitere Dienste des Verlags in Anspruch nehmen wollen? Eine rhetorische Frage.
Es gibt, wie oben gesagt, keine Musterlösungen. Und das bedeutet, die Medienkonzerne müssen wie Wissenschaftler experimentieren. Davon ist bisher wenig zu sehen. Warum, zum Beispiel, stellt kein Medienhaus seine Online-Leser vor die Wahl: freier Zugang mit eingeblendeter Werbung – oder ein werbefreier Abo-Zugang? Jeff Jarvis machte vor einigen Jahren schon den Vorschlag, Leser an den Werbeeinnahmen zu beteiligen – wenn sie dafür mehr Daten von sich preisgeben.
Es gibt noch viel zu experimentieren – fangt endlich an!



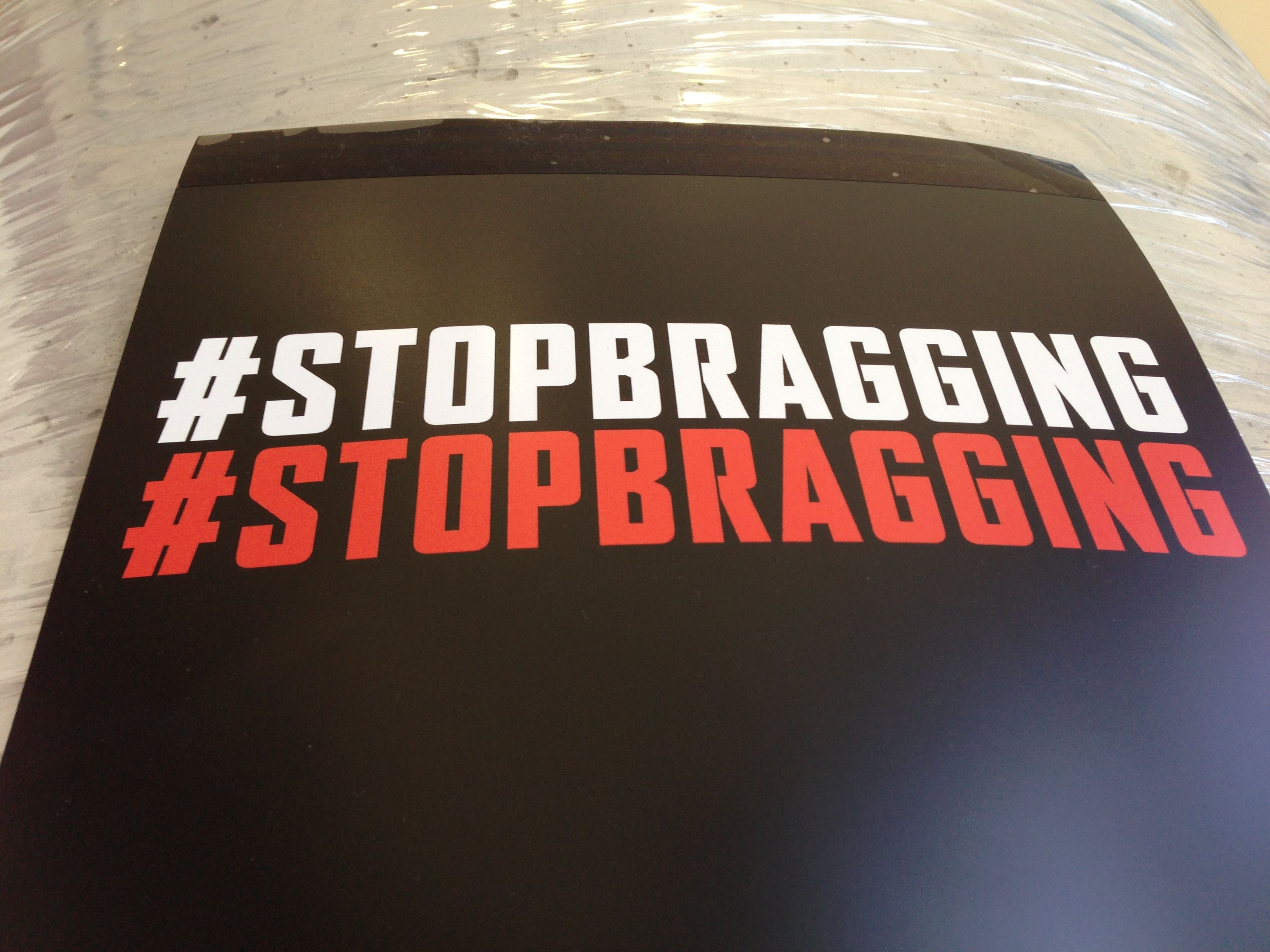


Kommentare
Dorian Gray 5. Juli 2013 um 12:13
Tolle Zusammenfassung! Aber eben, erzähl das jemandem, der all die genialen neuen Medien nicht kennt, sie nicht liest, sich bislang wirklich gar nicht bewusst war, was da „draussen“ alles geschieht. Ich verweise Bekannte regelmässig auf Matter, TheVerge, GuardianEnvironment-Blognetzwerk, Spielverlagerung, undundund… Aber, so absurd das klingt, in der Schweiz gehörst du als Konsument von solchen Onlinemedien zu einer winzigen Minderheit. Auch unter den Medienschaffenden kennt sich nur ein kleiner Teil in dieser „anderen Welt“ aus.
Philip Engstrand 5. Juli 2013 um 15:56
Um auf den letzen Absatz einzugehen:
Die Lösung ist natürlich, freier Zugang mit ausgeblendeter Werbung.
Stefan 11. Juli 2013 um 0:19
Sie haben aber schon kurz in die Kommentare geschaut, als die Verlage kürzlich um die Deaktivierung der Adblocker baten oder nun über Adblock Plus berichtet haben? Da taten sich Abgründe auf, wenn es um den Respekt des Lesers vor dem „Wert“ des geschriebenen Wortes ging. Auch das ist eine Realität: Nachrichten, aber auch andere Inhalte, werden heute von vielen Lesern als beliebig konsumierbare Allgemeingüter angesehen, die eine Bezahlung nicht „verdient“ haben. Frei übersetzt lauteten viele Kommentare: „Jetzt haben mir die Abmahnanwälte schon die kostenlosen Musik- und Filmdownloads genommen, dann will ich wenigstens den Rest für lau.“ An Adblockern scheitert nämlich schon die erste Wahl in Ihrem letzten Abschnitt: freier Zugang mit eingeblendeter Werbung ist mit derart bewaffneten Lesern keine Option mehr.
Thomas Knüwer 11. Juli 2013 um 13:29
Sorry, das sehe ich anders. Die Zahlungsbereitschaft der Leser ist bei nachrichtlichen Inhalten online nicht gegeben. Grund: Man kann die Qualität der Ware erst nach Lektüre bestimmen – und man weiß, dass die Ware exakt einmal konsumiert wird. Angesichts der Flut aggressiver Werbung ist das Betteln um das Abschalten des Adblockers logischerweise eine aggressive Reaktion wert. Warum aber hat eigentlich noch nie ein Verlag angeboten, gegen Bezahlung jedwede Werbe- oder Tracking-Maßnahme abzuschalten? Wäre doch mal ein spannendes Experiment, oder?
Sturm im Wasserglas? Der erste “Social Media Redakteur” einer Regionalzeitung – Der fukaiko-Blog. 12. Juli 2013 um 15:27
[…] an: Nicht zu Unrecht prangert Thomas Knüwer (Indiskretion Ehrensache) in seinem Artikel “Fangt endlich an!” die Haltung der Zeitungen und Verlage zum Thema Qualitätsjournalismus, Paid Content und […]